“Die besondere Stärke religiöser Gemeinden liegt in ihrer Funktion als niederschwelliger lokaler Zugangspunkt”
Ein Interview mit Alexander Kenneth Nagel
Ein Interview mit Alexander Kenneth Nagel
Alexander Kenneth Nagel: Religiöse Gemeinden bieten ein breites Spektrum an Unterstützung an, das über materielle oder finanzielle Hilfe hinausgeht. Die Palette reicht von der Bereitstellung von Sachspenden und Unterkünften über die Vermittlung von Sprachkursen und Freizeitangeboten bis hin zu sozialen Dienstleistungen wie Rechtsberatung und psychosozialer Betreuung (Seelsorge).
Dabei liegt die besondere Stärke der Gemeinden in ihrer Funktion als niederschwelliger, lokaler Zugangspunkt. Sie sind oft die erste Anlaufstelle, die Geflüchtete in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft finden. Dadurch können sie helfen, initiale bürokratische Hürden zu überwinden. Wo staatliche Stellen primär administrative oder finanzielle Unterstützung leisten, können Religionsgemeinschaften soziale und emotionale Hilfe gewähren, die unabdingbar ist, um die soziale Isolation zu überwinden und psychischen Halt zu finden.
Auch wenn sich laut der SOEP-IAB-BAMF-Befragung eine deutliche Mehrheit von Geflüchteten einer religiösen Tradition zurechnet, gibt es auch hier religionslose und religionskritische Personen, die Religionsgemeinschaften trotz muttersprachlicher Angebote eher meiden würden. Diese können auch bei nicht-religiösen Migrantenselbstorganisationen Unterstützung erfahren, wie ein umfangreicher Forschungsbericht des Sachverständigenrates für Integration und Migration aus dem Jahr 2020 belegt.
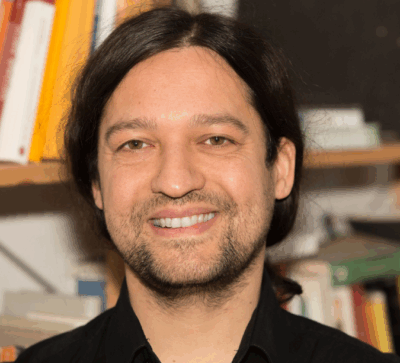
Unser Autor Alexander-Kenneth Nagel ist Religionswissenschaftler an der Georg-August- Universität in Göttingen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Immigration, religiöse Pluralisierung und interreligiöse Begegnung in Deutschland. Er leitete oder beteiligte sich an einer Reihe internationaler Verbundforschungsprojekte, darunter eine Nachwuchsgruppe zu „Civic potentials of religious immigrant communities“ (2009-2014) sowie ein Horizon 2020-Projekt zur „Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond“ (RESPOND, 2017-2021).
Alexander Kenneth Nagel: In der Rückschau lassen sich bei der Flüchtlingshilfe durch religiöse Migrantengemeinden mehrere Phasen unterscheiden: In der anfänglichen Akutphase (2015/2016) war das Engagement von einer spontanen Ad-hoc-Hilfe geprägt, um die unmittelbare Notlage zu lindern. Dabei standen gerade muslimische Gemeinden im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, da sie als sprachliche und kulturelle Brückenbauer angesehen wurden.
In der darauf folgenden Konsolidierungsphase verlagerte sich der Fokus von einer reaktiven Notfallhilfe auf ein proaktives langfristiges Integrationsmanagement. Auch wenn einzelne Gemeinden in diesem Rahmen freie Träger der Wohlfahrtspflege ausgegründet haben und neue Institutionen wie Empowermentprojekte oder die „Koordinierungsstelle muslimisches Engagement in NRW“ hinzukamen, führte dieser Übergang in der Breite nicht zu einer Intensivierung oder Verstetigung der Wohlfahrtsproduktion religiöser Migrantengemeinden. Diese blieben vielmehr ihrem niedrigschwelligen und persönlichen Unterstützungsmodell treu, etwa in Form von informellen Patenschaften.
Eine weitere Phase war der Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs. Hier waren es neben den verfassten Kirchen vor allem russischsprachige Freikirchen, die mit gezielten Hilfsangeboten ukrainische Geflüchtete angesprochen haben. Zugleich führten der unterschiedliche Zugang zu Sozialleistungen und Verwerfungen in der öffentlichen Debatte zu einer Art Anspruchskonkurrenz zwischen Geflüchteten aus der MENA-Region und solchen aus der Ukraine.
Alexander Kenneth Nagel: Das größte Potenzial religiöser Gemeinden liegt in der Bereitstellung von sozialem Kapital und der Vertrauensbasis. Die Hilfe beruht auf persönlichen Beziehungen und einer tiefen lokalen Verankerung, die stabile und zuverlässige Netzwerke schafft. Die Akteure sind hoch motiviert und arbeiten in der Regel ehrenamtlich. Diese persönliche Nähe schafft Vertrauen, das im oft bürokratischen und distanzierten Umgang mit staatlichen Stellen fehlen kann.
Während staatliche Systeme auf Standardisierung und Kontrolle ausgerichtet sind, was bei Schutzsuchenden anfänglich Misstrauen hervorrufen kann, fungieren religiöse Gemeinden als Vermittler. Sie bereiten Geflüchtete emotional und sozial darauf vor, sich auf die formalen, notwendigen behördlichen Prozesse einzulassen. Ihre unbürokratische, netzwerkartige Struktur ist ein entscheidender Vorteil, da sie schnelle und unkomplizierte Hilfe an den Orten leisten können, wo sie am dringendsten benötigt wird.
Alexander Kenneth Nagel: Ja, es gibt strukturelle Unterschiede, die primär den Organisationsgrad und die Ressourcenverfügbarkeit betreffen. Etablierte Großkirchen, wie die katholische oder evangelische Kirche, können auf große, institutionalisierte Wohlfahrtsstrukturen (Caritas, Diakonie) zurückgreifen. Religiöse Migrantengemeinden sind demgegenüber wie andere Migrantenselbstorganisationen auch stärker auf flexible, informelle Netzwerke und das direkte Engagement ihrer Mitglieder angewiesen.
Zugleich verfügen sie über einen niedrigschwelligen Zugang zu Geflüchteten und können ihre Anliegen und Bedürfnisse spezifischer adressieren. Daher erscheint es sinnvoll, Moscheevereine oder Migrationskirchen in lokale oder regionale Netzwerke einzubeziehen, die auch etablierte Träger und andere zivilgesellschaftliche Verbände, etwa die verfassten Kirchen oder die Sozialpartner, umfassen. Dabei sollten die Netzwerke selbst als Zuwendungsempfänger fungieren und ihre Maßnahmen von Anfang an arbeitsteilig gemäß den Stärken der beteiligten Akteure planen.
Alexander Kenneth Nagel: Religionsgemeinschaften können auf zwei Ebenen die berufliche Integration von Geflüchteten begünstigen: durch Qualifikation und Vernetzung. Auf der Ebene der Qualifikation können sie entweder selbst im Rahmen ihres Angebotsspektrums niedrigschwellige Bildungsangebote machen (etwa Sprachkurse oder Unterstützung bei Hausaufgaben und Bewerbungen) oder Wissen über das Bildungssystem vermitteln und dadurch Bildungsentscheidungen erleichtern. Schließlich können sie Geflüchtete auch dabei Unterstützung, die Beschäftigungsmotivation auch bei langen Wartezeiten und bürokratischen Hürden aufrechtzuerhalten.
Auf der Ebene der Vernetzung können sie als Brückenbauer zur Arbeitswelt fungieren, indem sie ihre informellen Netzwerke zu lokalen Arbeitgebern, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), nutzen. Auf diese Weise können Religionsgemeinschaften dabei helfen, das Problem fehlender formaler Empfehlungen zu überwinden, dass vielen Geflüchteten den Arbeitsmarktzugang versperrt. In den informellen Netzwerken wird die Glaubwürdigkeit des Geflüchteten durch das sogenannte „Vouching“ der Gemeinde ersetzt. Diese informelle Validierung der Arbeitsbereitschaft und Zuverlässigkeit ist für kleine Betriebe oft entscheidender als die formale Anerkennung von Zeugnissen. Durch die Nutzung dieser informellen Kanäle ermöglichen die Gemeinden eine schnellere wirtschaftliche Selbstständigkeit, oft bevor formale Anerkennungsverfahren abgeschlossen sind.
“Das größte Potenzial religiöser Gemeinden liegt in der Bereitstellung von sozialem Kapital und der Vertrauensbasis. “
Alexander Kenneth Nagel
“Die Stärke von Religionsgemeinschaften besteht in der niedrigschwelligen Ansprache von Geflüchteten in Form einer Komm-Struktur.”
Alexander Kenneth Nagel
Alexander Kenneth Nagel: Auch wenn Religionsgemeinschaften das Leben ihrer Mitglieder auf vielerlei Weise positiv beeinflussen können, sind es keine Bildungsträger oder Beschäftigungsagenturen und wollen es auch nicht sein. Ihre Stärke besteht in der niedrigschwelligen Ansprache von Geflüchteten in Form einer Komm-Struktur. Demgegenüber sind formale und institutionelle Hilfsangebote in der Regel Geh-Strukturen, die mit logistischen und sozialen Hürden behaftet sein können.
Für die Verknüpfung sind ganz unterschiedliche Modelle denkbar: In der Corona-Zeit haben Gesundheitsämter mit religiösen Migrantengemeinden zusammengearbeitet, um über die Impfung und Social Distancing zu informieren. Parallel dazu wäre denkbar, dass Vertreter von Bildungsträgern und Beschäftigungsagenturen in die Gemeinden gehen oder aber in Kooperation mit ihnen eine Art Messe organisieren. Hier kommen Schnittstellenakteure wie Integrationsbeauftragte, Quartiersmanager oder lokale Räte der Religionen ins Spiel, die im besten Falle über Kontakte auf beiden Seiten verfügen.
Insgesamt scheint es mir wichtig, dass die beteiligten Akteure ihre Möglichkeiten und Grenzen transparent kommunizieren: Religiöse Migrantengemeinden sollten angesichts knapper Zeit- und Personalressourcen nicht mit zu hohen Erwartungen konfrontiert werden. Und Bildungs- und Beschäftigungsträger sollten deutlich machen, dass sie hinter bestimmte Anforderungen von Qualifikation und Verbindlichkeit nicht zurückkommen.
Alexander Kenneth Nagel: Impulse für die künftige Zusammenarbeit können auf ganz unterschiedlichen Ebenen ansetzen. So liegt eine Stärkung der bereits angesprochenen Schnittstellenakteure gleichermaßen in den Interessen von Migrantenselbstorganisationen und Beschäftigungsträgern. Eine weitere Ebene betrifft die Dokumentation und ggf. Anerkennung von Bildungserfolgen, die innerhalb der Gemeinden erzielt werden, also die Überführung von informeller in formale Bildung. Die größten Chancen liegen aber aus meiner Sicht auf den personellen Potentialen religiöser Migrantengemeinden.
Dies betrifft zum einen die einschlägige Weiterqualifizierung. So sollten Ehrenamtliche und Gemeindeleiter:innen in die Lage versetzt werden, Unterstützungsbedarfe zu erkennen und Brücken zu den zuständigen Institutionen zu schlagen. Dabei ist es wichtig, in Weiterbildungsformaten (etwa zur Integrationslotsin) die Opportunitätskosten für die Teilnehmenden im Blick zu behalten und nach Möglichkeit zu kompensieren. Optionen dafür wären Aufwandsentschädigungen oder die Bündelung verschiedener Module in einem zertifizierten Weiterbildungsprogramm. In besonderen Fällen wäre auch die Vermittlung in ein berufsbegleitendes Studium (ggf. in Verbindung mit einem Teilstipendium) der Sozialarbeit oder Sozialpädagogik denkbar.
Eine zweite Ebene ist die Aktivierung von fachlich einschlägig qualifizierten Angehörigen der zweiten Generation (s. o.) und ihre Überführung in eine hauptamtliche Tätigkeit mit Gemeindebezug (etwa analog zu gemeindepädagogischen Berufsbildern im landeskirchlichen Kontext). Dazu könnten sich z. B. verschiedene Gemeinden in einem Stadtteil zu einer Art diakonischem Kollektiv zusammentun und gemeinsam eine gGmbH gründen, die dann (zu Beginn mit öffentlichen Zuschüssen) die entsprechenden Personen beschäftigt. Flankierend wäre es wichtig, die Mitwirkungsmöglichkeiten dieser gemeindeübergreifenden Sozialarbeiter:innen innerhalb der Gemeinden auszubauen, etwa im Sinne einer Einbeziehung in den Vorstand.